AK: Ob etwas wirklich Quatsch ist, zeigt sich im Grunde erst dann, wenn es sich bei der Anwendung beweisen soll. Wobei neue Dinge nicht unbedingt besser sind als alte – wie das Beispiel der Kurbeltaschenlampe zeigt, die schon viele Jahrzehnte alt ist (und bei mir im Kapitel „Muskelkraft“ aufgeführt wird). Die Rucksack-Ladetechnik wurde hingegen primär für Soldaten entwickelt, die sowieso mit Rucksäcken durchs Feld ziehen und ihre Hände für den Waffengebrauch benötigen. Man sollte bei einer Bewertung also stets die Grundprämissen und die Umgebungsbedingen im Auge behalten. Wobei ich meine Aufgabe nicht darin sehe, etwas als gut oder schlecht zu bezeichnen.
DW: Hier fällt mir ein Punkt ein, der mir häufig zu schaffen macht. Kritiker der erneuerbaren Energien halten diese ja für völlig unwirtschaftlich und gar nicht so öko. Die riesigen Windkraftparks erzeugen ja nun tatsächlich Infraschall, Naturschützer beklagen auch deren Einfluss auf die Artenvielfalt. Solarzellen benötigen seltene Erden und sind auch nicht ewig haltbar, da steht also auch eine riesige Austauschwelle an, wenn ich das richtig sehe. Haben Sie dazu eine Position? Ich frage mich manchmal tatsächlich, ob wir nur vom Regen in die Traufe kommen. So viel Elektroschrott haben die Kohle- und Atomkraftwerke jedenfalls nicht produziert, um mal ein wenig zu sticheln …
AK: Da haben Sie den Finger in die Wunde gelegt. Zum Thema Windkraft hatte ich ja schon einige Anmerkungen gemacht – und bewegungsfreie Systeme erzeugen auch keinen Infraschall oder erschlagen Vögel. Wobei auch ich etwas sticheln und an die wiederholten Fälle entsprechender Zählungen erinnern möchte, wo sich nachträglich herausstellte, dass es Umweltschützer waren, die Vogel- bzw. Fledermauskadaver um die Rotoren verteilt hatten.
Bei den Solarzellen möchte ich wiederum auf einen einfachen Fakt verweisen: Wo es ein Bedarf gibt, schafft der Markt ein Angebot. Es gibt bereits mehrere Firmen, die sich auf das Zellen-Recycling konzentrieren. Und wenn in der kommenden oder darauffolgenden Technologiegeneration Farbstoffsolarzellen zum Einsatz kommen, könnte man diese – leicht übertrieben – schon fast kompostieren. Denn diese nach ihrem Erfinder benannten Grätzelzellen arbeiten bionisch, das heißt auf Basis organischer Farbstoffe.
DW: Das andere häufig diskutierte Problem bei regenerativen Energien ist das Speicherproblem. Haben Sie im Laufe Ihrer Recherchen Ideen gefunden, die das bereits gelöst haben?
AK: Oh ja, auch in diesem Bereich gibt es eine Vielzahl von Technologien, auch wenn die ganze Welt so tut, als gäbe es nur Lithium-Ionen-Akkus. Ich selbst bin ein großer Fan von mechanischen Systemen, die unter dem Stichwort „Lageenergie“ firmieren und ganz genau wie Pumpspeicherkraftwerke funktionieren: Überschussstrom wird verwendet, um schwere Massen (Betonblöcke, Kieselsteine usw.) in die Höhe zu hieven. Wird der Strom wieder benötigt, werden die Massen heruntergelassen und mittels Generatoren Elektrizität erzeugt. Leider bin ich auch bei diesem Kapitelteil noch nicht dazu gekommen, die neuesten Informationen einzuarbeiten, aber auch mit dem Stand von 2013 finden sich diverse Versuche, Experimente und Umsetzungen, über die man sich informieren kann.15
Ebenso gibt es Schwungrad-Energiespeicher, supraleitende Magnetspeicher, diverse hydraulische Speicher, Druckluft-Speicher, verschiedene thermische Speicher, chemische Speicher und, und, und … dokumentiert sind sie im Teil C im Unterkapitel „Energiespeichern“.
DW: Und die funktionieren auch alle und sind nicht nur gut gemeinte Ideen von ein paar Nerds? Man hat ja von außen das Gefühl, dass die Wissenschaft forscht und forscht, aber doch nichts richtig vorangeht in dem Bereich. Oder liegt das wieder nur daran, dass man eine Monotechnologie für alle sucht, die sich massenhaft vermarkten lässt? Denken wir doch nochmal an Hans Otto, der seinen Solar-Überstrom zu Hause speichern will. Gibt es eine erschwingliche und funktionierende Technik, auf die Sie ihn hinweisen könnten?
AK: Nun, ich konnte mir die Systeme natürlich nicht anschauen, denn auf alle Bereiche angewandt würde dies eine fast ununterbrochene Reisetätigkeit bedeuten. In den Primär- und Sekundärquellen lässt sich aber oftmals genug finden, das eine tatsächliche Funktion belegt, unabhängig davon, ob die jeweilige Technologie auch sinnvoll oder wirtschaftlich ist.
Zudem muss unterschieden werden zwischen der Forschung, die oftmals einen Selbstzweck darstellt, und der produktionstechnischen Umsetzung, die völlig anderen Kriterien unterliegt und andere Interessen hat.
Solar-Überstrom zu Hause zu speichern ist ein gutes Beispiel, danke für diese Vorlage. Auf Forschungsebene gibt es schon seit Jahrzehnten entsprechende Möglichkeiten, doch umsetzen konnten sie nur versierte Bastler in Heimarbeit. Erst in den letzten Jahren begannen leistungsfähige Unternehmen, die Speicher als Produkte auf den Markt zu bringen, wie z. B. Tesla mit der Powerwall. Hier begegnet uns ein weiteres Phänomen: Erst dann, wenn die erste Firma mit so etwas herauskommt, ziehen die anderen nach. Weshalb es inzwischen auch die sonnenBatterie, die SENEC.Home-Speicher, den Stromspeicher von RCT Power, den Junelight von Siemens und viele andere gibt.
DW: Verabschieden wir uns zum Ende des Interviews hin noch einmal von den konventionellen Energietechnologien, falls man die bisher geschilderten Erfindungen überhaupt so nennen kann. Wie sieht denn Ihre Vision für eine andere Energieversorgung der Welt aus? Ich habe beim Blättern in Ihrem Buch oft den Begriff „Synergie“ aufgeschnappt, aber Sie reden auch von „Exergie“ – könnten Sie diese Begriffe bzw. Ihr Konzept dahinter näher erläutern?
AK: Für mich bedeutet Synergie ganz einfach 1 + 1 = 3 oder 4 oder sogar mehr. Exergie dagegen ist der Fachbegriff für reine Nutzenergie. Wollen wir also eine kluge Lösung für die Energiefrage finden, dann lautet die Frage: Mittels welcher synergetischer Effekte erziele ich die höchste Exergie-Ausbeute, wobei ich selbst die geringstmögliche Menge an Energie investiere, während der Rest aus den diversen Energieformen der uns umgebenden Natur stammt. Also dem ganzen einen Schubs geben – und nicht die ganze Strecke schieben müssen …
DW: Holla, das klingt fast nach dem guten alten Selbstläufer, den die klassische Physik nicht sehen will. Sie haben die Idee ja schon weitergedacht, daher würde ich zuletzt gern noch etwas darüber plaudern. Was wäre denn Ihrer Meinung nach die Lösung für das Energieproblem – und wie kommen wir da hin? Wenn ich das richtig verstehe, favorisieren Sie hier die Wirbelphysik?
AK: Ja, richtig. An dieser Stelle sollte die klassische Physik langsam mal erwachsen werden und ihre renitente Verweigerungshaltung aufgeben. Selbstverständlich kann aus Nichts nichts entstehen – sonst wäre es ja kein Nichts. Aber wenn ein Bauer 100 Tage arbeitet und dabei Nahrung für 1.000 Tage erwirtschaftet, indem er primär die kostenlose Sonnenenergie nutzt, dann wird das akzeptiert. Und auch wenn ein Wasserkraftwerk Strom erzeugt, weil vorher Millionen Tonnen verdunstet und später abgeregnet sind, wobei sie unter anderem auch Stauseen nachfüllen, macht keiner ein Fass auf. Ich denke, dass man mit einem intelligenten Einsatz der Wirbelphysik bestehende Energieformen unserer Umwelt nutzen kann, um natürliche Kreisläufe nachzuahmen und somit viel direkter zu nutzen.
DW: Womit wir wieder bei der Messias-Maschine wären. Ich werfe hier jetzt mal das Stichwort „Freie Energie“ in den Raum. Natürlich haben Sie auch Systeme kartografiert, die unter diesem Stichwort laufen. Welche Erfindungen und Entwicklungsrichtungen in diesem Bereich würden Sie als die derzeit vielversprechendsten bezeichnen?
AK: Sind Sie mir böse, wenn ich hier die Antwort verweigere? Zumal der Begriff „Freie Energie“ sehr unglücklich ist. Wir wissen zwar alle, was damit gemeint ist, aber tatsächlich handelt es sich um einen Fachbegriff der Physik für ein thermodynamisches Potenzial, das auch als „Helmholtz-Potenzial“ oder „Helmholtz-Energie“ nach Hermann von Helmholtz bezeichnet wird. Und nun stellen Sie sich bitte vor, welchen Eindruck ein gestandener Physikprofessor bekommt, wenn ihm ein begeisterter Erfinder den Begriff vorlegt, dabei aber etwas völlig anderes meint. Wie sollen die beiden je zusammenkommen?
Dass mit dem „frei“ eigentlich gemeint ist, dass die jeweilige Energieform nicht über einen kostenpflichtigen Stromzähler läuft, ist keine Entschuldigung für diese falsche Begrifflichkeit. Und wer behauptet, dass diese „neuen Energien“, wie ich sie lieber bezeichne, kostenlos sein werden, ist ein Träumer. Mag sein, dass sie keine Rohstoffe verbrauchen, aber das tun Solaranlagen, Wasser- und Windkraftwerke auch nicht. Sie müssen dennoch erst einmal mit oftmals hohen Kosten entwickelt und produziert, errichtet und langfristig auch gewartet werden. Was bei den neuen Energien nicht anders sein wird.
DW: Meinen Sie, dass wir je eine solch ominöse Maschine zu Gesicht bekommen werden? Man wird ja in dem Bereich oft enttäuscht, denn großspurige Ankündigungen gibt es zuhauf … Keshe, Keppe, Orbo, Mills, Danzik und Co. Als langjähriger Beobachter der Szene braucht man da schon einen langen Atem oder wendet sich nach der x-ten Versandung davon ab.
AK: Das liegt an den oftmals unhaltbaren Versprechungen. Heute erfunden und morgen die Welt verändert – das funktioniert nicht. Das eine ist, eine solche Maschine zu haben, das andere, ihr Signifikanz zu verleihen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass eine ganze Reihe der neuen Geräte tatsächlich funktioniert, wobei man gar nicht erst lange suchen muss. Ein Gerät, das z. B. alleine durch Luftdruckschwankungen Arbeit leistet, würde dem Kriterium ja entsprechen. Und so etwas gibt es schon seit über 140 Jahren, man sehe sich nur die von dem österreichischen Ingenieur Friedrich Ritter von Lössl angefertigte autodynamische Uhr an.16 Aber signifikant ist diese Technologie trotzdem nicht, da man kaum etwas größeres als ein Uhrwerk damit betreiben kann.
Hier möchte ich ein Rechenbeispiel aufführen: Nehmen wir an, wir hätten die tolle neue, koffergroße Maschine, die aus kosmischer Strahlung (oder was auch immer sonst) einen Output von 10 kW erzielt, und dies 24 Stunden am Tag. Damit ließen sich nach hiesigem Standard etwa drei Haushalte autonom versorgen. Signifikant wird diese Maschine aber erst, wenn sie auch in hohen Stückzahlen auf den Markt kommt. Also entführen wir Bill Gates, bekommen eine Milliarde Euro Lösegeld und beginnen mit dem Bau einer Gigafactory. Abgesehen von dem Bau und der Einrichtung der Produktionslinien dauert es einige Zeit, bis diese ohne allzu viel Ausschuss laufen. Doch selbst wenn wir dann in einen 24-Stunden-Betrieb gehen und einen Ausstoß von 10.000 Maschinen pro Tag erreichen, bedarf es einer ganzen Jahresproduktion, um alleine nur den Bedarf einer Stadt wie Berlin zu decken. Bis sich die neue Energie also in irgendeiner globalen Statistik mit auch nur dem winzigsten Peak zeigt, wird es Jahrzehnte dauern. Woran auch eine zweite oder dritte Fabrik nicht viel ändert. Leider vergessen fast alle Erfinder in ihrer Begeisterung, dass technisch-industrielle Kreisläufe genauso zeitlichen Abläufen unterliegen wie alles andere. Weder lassen sich Pflanzen schneller ernten, indem wir an ihnen ziehen, noch kühlt eine Schweißnaht in einer Mikrosekunde ab. Das eine oder andere können wir vielleicht etwas beschleunigen, wie z. B. Lieferzeiten, aber das war’s auch schon.
DW: Ja, so etwas übersehe ich in meinem Idealismus auch gern. Allerdings muss die Signifikanz ja irgendwo anfangen, und da wir aufgeschlossene und neophile Leser haben, würde ich dennoch gern die für Sie persönlich interessantesten aktuellen Entwicklungen hören. Sie müssen hier ja keine Gewähr geben – nur eine Anregung zum Weiterrecherchieren. Ich hatte zum Beispiel einen guten Eindruck von Dennis Danzik und der Earth Engine.
AK: Da muss ich mich entschuldigen, denn bislang habe ich mich noch nicht mit der Earth Engine beschäftigen können. Eigentlich kann ich auch nur „nach Gefühl“ urteilen, denn mir fehlt die fachliche Kompetenz eines Physikers, Chemikers oder Mathematikers, um verlässliche Beurteilungen abgeben zu können. Aber ich nenne Ihnen gerne ein paar Fälle, bei denen ich dieses gute Gefühl hatte: So hat mir Andrea Rossi, den ich auf einem der Schneider-Kongresse dolmetschen durfte (denn das mache ich manchmal auch noch) sehr gut gefallen. Besonders seine ehrliche Aussage, dass er auch nicht genau weiß, wie sein Energiekatalysator funktionieren würde, ihm dieses als Ingenieur aber egal sei – er weiß, dass der E-Cat funktioniert und will ihn schließlich nur verkaufen. Das fand ich ungemein erfrischend gegenüber den vielen selbstgestrickten Erklärungen, die häufig mit eigenen Termini das „Wasser mit Wasser erklären“, wie dies ein arabischen Sprichwort beschreiben würde. Ebenso bin ich überzeugt davon, dass die Mehrschichtfolien von Holger Thorsten Schubart eine Zukunft haben – aber warum muss er behaupten, dass diese ihre Energie aus Neutrinos erhalten, solange er dafür keine nachprüfbaren Beweise hat? Nach bisherigem Stand des Wissens lassen sich die subatomaren Teilchen durch nichts einfangen und gehen ungebremst durch den ganzen Planeten hindurch. Damit will ich nicht sagen, dass Schubart falsch liegt, aber die konventionelle Wissenschaft wird ihn deshalb ungeprüft ablehnen, ähnlich wie es so vielen anderen Erfindern neuartiger Energien oder Energieumwandlungsmethoden geht. Weitere Technologien mit hohem Potenzial werden in dem bereits erwähnten Bericht von Bischof, Ludwig und Manthey aufgeführt.

Andrea Rossi
DW: Ihr „Buch der Synergie“ hat ja inzwischen solche Ausmaße angenommen, dass Sie es offenbar alleine gar nicht up to date halten können. Liegt das daran, dass es so viele neue Entwicklungen in all diesen Bereichen gibt? Wenn Sie an Ihre Anfangszeit zurückdenken – da hat sich doch einiges geändert, oder?

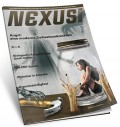
 Eine Begegnung mit der „Messias-Maschine“ und ihrem Erfinder katapultierte Achmed Khammas 1975 auf einen Pfad, den er nicht mehr verlassen hat. Bis heute trägt er im „Buch der Synergie“ ein Konvolut an Technologien zusammen, die uns in ein neues, nachhaltiges und naturnahes Energiezeitalter bringen könnten. Ein ausführlicher Dialog über seltsame und weniger seltsame Maschinen, Heureka-Momente und die Frage, warum wir immer noch nicht dort sind, wo wir eigentlich längst sein sollten.
Eine Begegnung mit der „Messias-Maschine“ und ihrem Erfinder katapultierte Achmed Khammas 1975 auf einen Pfad, den er nicht mehr verlassen hat. Bis heute trägt er im „Buch der Synergie“ ein Konvolut an Technologien zusammen, die uns in ein neues, nachhaltiges und naturnahes Energiezeitalter bringen könnten. Ein ausführlicher Dialog über seltsame und weniger seltsame Maschinen, Heureka-Momente und die Frage, warum wir immer noch nicht dort sind, wo wir eigentlich längst sein sollten. Daniel Wagner ist Herausgeber und Chefredakteur des deutschen NEXUS-Magazins. Wenn er nicht gerade damit beschäftigt ist, fremde Texte zu bewerten und den bürokratischen Apparat zu füttern, greift er selbst zur Feder. Seine Interessen flattern am Horizont.
Daniel Wagner ist Herausgeber und Chefredakteur des deutschen NEXUS-Magazins. Wenn er nicht gerade damit beschäftigt ist, fremde Texte zu bewerten und den bürokratischen Apparat zu füttern, greift er selbst zur Feder. Seine Interessen flattern am Horizont.
Kommentar schreiben