Von wegen „friedliche Volksrevolution“ 1989: Der Mauerfall und die deutsche Einheit waren von langer Hand geplant und Teil einer Langzeitstrategie, deren finale Züge wir gerade vor unseren Augen erleben. Michael Wolski war damals als Außenhändler live dabei; seine Erfahrungen und Recherchen geben zu denken. Wer zieht da im Hintergrund des Weltgeschehens die Fäden?
NEXUS: Herr Wolski, in Ihren Büchern zum Berliner Mauerfall erzählen Sie eine völlig andere Geschichte als die von der friedlichen, vom Volk ausgehenden Revolution. Ihr Verdachtsmoment, dass der Mauerfall schon lang hinter den Kulissen geplant und letztlich mithilfe der Geheimdienste umgesetzt wurde, entstand, als Sie in Ihrer Tätigkeit schon ein halbes Jahr vor der eigentlichen Währungsunion und letztlichen deutschen Einheit informiert wurden, dass es „keine DDR mehr geben wird“. Wo waren Sie damals tätig und wie kam es dazu?
Michael Wolski (MW): Seit 1986 war ich – Außenhändler – im Verbindungsbüro eines US-Konzerns im Ostberliner Internationalen Handelszentrum (IHZ) als „Leiharbeiter“ tätig. Im Sommer 1985 waren vier US-Konzerne im Außenhandelsministerium vorstellig geworden und wollten Verbindungsbüros eröffnen. Eigenartigerweise wollten sie aber nur Ostberliner einstellen, keine Westberliner. Alle diese Konzerne hatten große Tochterunternehmen in der BRD. So begann die IHZ GmbH die Suche nach geeigneten Kandidaten, die sie als Leiharbeiter den Firmen vorstellen konnte.
Zum Ende der DDR 1990 wurde ich vom Konzern übernommen und nach Moskau versetzt, um das Verbindungsbüro in der Sowjetunion aufzubauen und zu führen. Erst zu diesem Zeitpunkt wurde mir klar, warum die Konzerne Ostberliner in ihren Verbindungsbüros haben wollten – sie wussten offenbar von den geopolitischen Änderungen, die mit Gorbatschows Machtantritt im März 1985 in Gang gesetzt wurden, und wollten lokales Personal für die Zeit nach der Wende rekrutieren. Das wäre mit Westberlinern kaum möglich gewesen.
Bis Ende 1997 lebte ich in Russland und wurde in dieser Zeit Zeuge der Putschversuche gegen Gorbatschow im August 1991, gegen Jelzin im September 1993 sowie der Privatisierung des Volkseigentums und des Aufstiegs der Oligarchen.
NEXUS: Der Außenhandel von Staaten ist keine Sache, mit der sich der Normalbürger beschäftigt. Zum Verständnis: Es gab doch damals auch einen „offiziellen“ Außenhandel der DDR? Sie erzählen aber auch, dass es da noch eine Entität gab – die sogenannte KoKo –, von der heute kaum noch jemand weiß, die aber mit Fug und Recht als „Tiefer Staat“ der DDR bezeichnet werden kann. Was war der Unterschied zum offiziellen, also planwirtschaftlichen Außenhandel?
MW: Für mich deutet alles darauf hin, dass die KoKo von den Sowjets eingerichtet wurde, um das Versagen des planwirtschaftlichen Außenhandels nach dem Mauerbau zu übertünchen. Ich vermute auch, dass mit den Deviseneinnahmen der KoKo gleichzeitig langfristige geopolitische Ziele verfolgt wurden.
Zur historischen Einordnung: Nach der Kapitulation der deutschen Wehrmacht 1945 teilten die vier Alliierten (Sowjetunion, USA, Großbritannien und Frankreich) Deutschland in Besatzungszonen auf, wobei die ehemalige Reichshauptstadt Berlin in vier Sektoren der Alliierten unterteilt wurde. Als kurz danach der Kalte Krieg begann, verschärften sich die Konflikte zwischen der Sowjetunion und den drei Westalliierten. So wurde 1949 auf Veranlassung der Westalliierten die BRD gegründet, kurz darauf folgte als Antwort der Sowjets die Gründung der DDR.
1961 hatten die Sowjets der DDR-Führung in Berlin den Mauerbau befohlen, um den bis zum 13. August 1961 möglichen freien Reiseverkehr zwischen den Westsektoren und dem sowjetischen Sektor in Berlin zu unterbrechen. Um es salopp zu sagen: Man überquerte damals die Straße und war im Westen. Mit dem Mauerbau wurde das Problem der Übersiedlung von Ostdeutschen in den Westen (die DDR nannte es Republikflucht) gelöst, doch man schuf sich damit ein viel größeres Problem, das die Existenz der DDR und die kommunistische Propaganda vom weltweiten Sieg des Sozialismus bedrohte: Schlagartig wurde klar, dass die sozialistische Planwirtschaft der Sowjetunion, die sämtlichen osteuropäischen Ländern nach 1945 übergestülpt worden war, nicht zum Sieg des Sozialismus führen würde. Warum? Diese Form der Planwirtschaft war von Lenin und Stalin entwickelt worden, passend für ein Land, das nicht industrialisiert war, aber über ausreichend Rohstoffe verfügte und Selbstversorger war. Export war nur notwendig, um die Industrialisierung der Sowjetunion voranzutreiben, speziell durch Importe von Anlagen und Ausrüstungen aus den USA und Deutschland. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Die Wirtschaft der DDR war ein Überbleibsel des Industrielandes Deutschland, wenn auch kriegsgeschädigt. Sie lebte vom internationalen Warenaustausch. Rohstoffe importieren, verarbeiten und dann Fertigerzeugnisse für Industrie und Endkunden weltweit zu exportieren. Die Übernahme der sowjetischen Planwirtschaft passte also wie der Sattel auf die Kuh. Die von den Ideologen nicht erkannte Bruchstelle war der Ersatzteilimport.
In der DDR-Planwirtschaft konnten nur konkrete Produkte in den Volkswirtschaftsplan eingestellt werden, Ersatzteilbedarf nach Havarien und sonstigen Ausfällen waren daher nicht planbar – man wusste ja nicht, was kaputtging. Einen unspezifizierten Pauschalbetrag in Devisen für Ersatzteile im Jahresplan des Betriebes wollte man aber offenbar wegen möglichen Missbrauchs vermeiden. Bis Sommer 1961 waren auch viele Maschinenbauer aus der Sowjetzone und späteren DDR in den Westen übergesiedelt, um der Enteignung zuvorzukommen, und hatten ihre Firma dort neu aufgebaut.
Sie hätten rasch liefern können – aber der DDR-Betrieb konnte nicht in Westmark zahlen. Die Ostmark war eine Binnenwährung, nicht konvertibel. Nur wenn der Import im laufenden Jahresplan enthalten war, stellte die Staatsbank der DDR Westmark zur Verfügung. Wie dargelegt, gab es bis zum 13. August 1961 keine Grenzkontrollen innerhalb Berlins. Also schickte der DDR-Betrieb einen Lkw in die Westsektoren und holte dort das bestellte Ersatzteil ab. Das Geld dafür wurde im Westen in der Wechselstube getauscht, was zwar nach DDR-Recht verboten war – aber der Zweck heiligte die Mittel.
Und hier beginnt die Geschichte des Bereichs Kommerzielle Koordinierung (KoKo). Alexander Schalck-Golodkowski (der später bis 1989 Chef der KoKo war) wurde 1962 zum 1. Sekretär der SED-Kreisleitung Außenhandel berufen und musste sich nun die Klagen der Generaldirektoren der Außenhandelsbetriebe anhören: Forderungen nach Senkung der Exportpläne, da Maschinen defekt und Reparaturen erst im neuen Planjahr möglich waren. Kein Abschluss neuer Exportverträge, also keine Deviseneinnahmen. Die DDR stand vor dem Bankrott. Ein besseres Geschenk hätten die Sowjets dem Westen nicht machen können.
Schalck-Golodkowski entwickelte einen Vorschlag für die Schaffung eines marktwirtschaftlichen Außenhandels, der neben dem planwirtschaftlichen existieren sollte. Dieser wurde jedoch erst 1965 – nach dem Sturz des sowjetischen Partei- und Staatsführers Chruschtschow im Oktober 1964 – genehmigt. 1966 beschloss der Ministerrat auf dem Verordnungswege die Schaffung des Bereichs Kommerzielle Koordinierung im Ministerium für Außenhandel, geleitet von Staatssekretär Schalck-Golodkowski. Ab 1972 bekam die KoKo die Zollhoheit – sie konnte nach Belieben die Zollkontrolle in den Grenzzollämtern aussetzen – und ihr wurde der Status des Devisenausländers zugesprochen. Das bedeutete, dass KoKo-Betriebe ihre eingenommenen Devisen nicht mehr an die Staatsbank abführen mussten. Die KoKo wurde Staat im Staate und Schalck-Golodkowski graue Eminenz im Hintergrund. Details lesen Sie in meinem Buch.
NEXUS: In ihrem Buch behandeln Sie den Berliner Mauerfall im Rahmen der sowjetischen Langzeitstrategie, in die auch die Devisen der KoKo eingewoben zu sein scheinen. Gehen wir doch noch einmal zu den Ereignissen um den Mauerfall am 9. November 1989. Was sind Ihre wichtigsten Verdachtsmomente, dass es da nicht mit rechten Dingen zuging? Gibt es dafürBelege –oder nur Indizien?
MW: Unmittelbar nach dem Mauerfall gab es nur Verwirrung. Auch bei den Außenhändlern, wobei einigen da schon klar war, dass die Tage der DDR gezählt waren. In der Nacht des Mauerfalls selbst hatte ich noch keinen Verdacht – nur ein Unwohlsein. Meine Zweifel begannen am 9. Januar 1990. Im Dezember 1989 hatte ich vom Chef der Schweizer Tochterfirma des Konzerns, die das Ostberliner Büro betrieb, den Auftrag bekommen, die Gründung einer Vertriebsgesellschaft des Konzerns für die DDR einzuleiten. Nach den Feiertagen zum Jahreswechsel begann ich damit. Am 9. Januar erhielt ich die Mitteilung: Alle Aktivitäten zur Firmengründung einstellen, es wird keine DDR mehr geben – wir übergeben das gesamte DDR-Geschäft der westdeutschen Tochterfirma. In meiner Verantwortung lag es, diese Übergabe bis zum 30. Juni 1990 zu vollziehen.
Ab diesem Tag, dem 9. Januar 1990, kam ich ins Sinnieren. Woher wusste man in der Konzernzentrale, dass es keine DDR mehr geben wird? In der Zeitung war davon nichts zu lesen. Erst am 13. Februar 1990 – also fünf Wochen später – teilten die Außenminister der vier Alliierten und der beiden deutschen Staaten mit, dass man Gespräche über eine deutsche Einheit aufnehmen werde. Im Mai 1990 erfuhren wir aus den Medien, dass die Wirtschafts- und Währungsunion am 1. Juli 1990 beginnen wird. Hatte man auch das in der Konzernzentrale gewusst und darum das Ende der Geschäftsübergabe auf den 30. Juni gesetzt?
NEXUS: Ihrer Meinung nach gingen diesem Tag auch weitere Schlüsselereignisse voraus, die die Geschichte von sowjetischer Seite her ins Rollen brachten. Welche waren das?
MW: Das, worüber ich jetzt berichte, hat sich erst einige Jahre nach der Vereinigung herausgestellt, als die Stasiarchive geöffnet wurden. Da ist zum einen die Weisung des Kommandos der Grenztruppen vom April 1989, den Schusswaffengebrauch bei Grenzdurchbrüchen zu untersagen. Dazu muss man wissen: Gorbatschow war der Oberbefehlshaber der Streitkräfte des 1955 geschlossenen Warschauer Vertrags, der als Verteidigungsbündnis die Westgrenze der sozialistischen Staaten gegen Angriffe vonseiten der NATO absichern sollte. Nachdem im Februar 1989 ein junger Ostberliner beim Überklettern der Sperranlagen an der Berliner Mauer erschossen worden war, stand das im PR-Konflikt zu Gorbatschows „gemeinsamen Haus Europa“. Nutzte er diese Steilvorlage der DDR, um den Schusswaffengebrauch im Hinblick auf den geplanten Mauerfall auszusetzen?
Als der neu gewählte SED-Generalsekretär Krenz am 1. November 1989 zum Amtsantritt bei Gorbatschow in Moskau weilte, erhielt er von Gorbatschow den Rat, für die am 4. November 1989 geplante Großdemonstration auf dem Alexanderplatz den Schusswaffeneinsatz der Polizei bei Aufruhr zu untersagen. Krenz erließ am 3. November dazu eine Weisung. Auch hier dürfte es sich um eine vorbereitende Maßnahme zur friedlichen Durchführung des 9. November gehandelt haben.
In meinem Buch führe ich weitere interessante Randdetails auf, die meines Erachtens einen unblutigen Regime-Change gewährleisten sollten, darunter die Kasernierung der etwa 340.000 sowjetischen Soldaten vom 6. bis 13. November 1989, der Einsatzbefehl für ausgewählte Geheimdienstoffiziere von KGB und GRU innerhalb der ostdeutschen Führungsriege vom 9. November 1989 oder die seltsame Verlängerung der Sitzung des Zentralkomitees der SED an jenem Abend. Da es damals noch keine Mobiltelefone gab, wurden an diesem Abend die wichtigsten Akteure der DDR nicht über die Lage an der Mauer informiert.

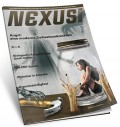
 War der Mauerfall von Moskau geplant? Michael Wolski, ehemaliger Außenhändler im Internationalen Handelszentrum der DDR, erlebte die Wende aus nächster Nähe – und erfuhr unbequeme Details. Bereits acht Wochen nach dem 9. November 1989 erhielt er eine brisante Mitteilung aus der Zentrale des US-Konzerns, für den er tätig war: „Es wird keine DDR mehr geben.“ Zu diesem Zeitpunkt hatte noch niemand öffentlich über eine Wiedervereinigung gesprochen. Im Interview rückt Wolski die Legende von der friedlichen Volksrevolution zurecht und skizziert eine Alternativgeschichte, in der sowjetische Geheimdienste und elitäre Netzwerke den Weg für eine europäische Perestroika ebneten. Das Finale erleben wir gerade.
War der Mauerfall von Moskau geplant? Michael Wolski, ehemaliger Außenhändler im Internationalen Handelszentrum der DDR, erlebte die Wende aus nächster Nähe – und erfuhr unbequeme Details. Bereits acht Wochen nach dem 9. November 1989 erhielt er eine brisante Mitteilung aus der Zentrale des US-Konzerns, für den er tätig war: „Es wird keine DDR mehr geben.“ Zu diesem Zeitpunkt hatte noch niemand öffentlich über eine Wiedervereinigung gesprochen. Im Interview rückt Wolski die Legende von der friedlichen Volksrevolution zurecht und skizziert eine Alternativgeschichte, in der sowjetische Geheimdienste und elitäre Netzwerke den Weg für eine europäische Perestroika ebneten. Das Finale erleben wir gerade. Daniel Wagner ist Herausgeber und Chefredakteur des deutschen NEXUS-Magazins. Wenn er nicht gerade damit beschäftigt ist, fremde Texte zu bewerten und den bürokratischen Apparat zu füttern, greift er selbst zur Feder. Seine Interessen flattern am Horizont.
Daniel Wagner ist Herausgeber und Chefredakteur des deutschen NEXUS-Magazins. Wenn er nicht gerade damit beschäftigt ist, fremde Texte zu bewerten und den bürokratischen Apparat zu füttern, greift er selbst zur Feder. Seine Interessen flattern am Horizont.
Kommentare
23. Oktober 2025, 08:49 Uhr, permalink
Drusius
Die Bücher von Herrn Wolski sind immer ein sehr gut recherchiertes und lohnenswertes Nachschlagewerk, der die Hintergrundaktivitäten der Steuernden aufdeckt.
Zwei Jahre vor der Umwandlung der DDR in die BRD wußte das State Department Germany der US-Regierung schon von der Umwandlung und hat das dem stellv. DDR-Außenminister mitgeteilt, so kann man es in verschiedenen Memoiren finden.
Die Steuerung im Hintergrund durch die globale Steuerung wird hin und wieder in unserer Geschichte sichtbar. DieUmwandlung der DDR war ein solcher Punkt.
Kommentar schreiben