Volksmund tut Wahrheit kund
Sokrates wusste es: Verletzungen der Seele werden durch den Körper sichtbar. Dieses Wissen entdecken wir mit der Universalbiologie gerade wieder und sind dabei auf einen biologischen Codex gestoßen, der sich innerhalb unserer Sprache manifestiert. Diese „Sprache der Organe“ drückt sich über Redewendungen aus, die aus uralten Zeiten stammen, durch den Volksmund weitergetragen wurden und bis heute verwendet werden. Es sind spezielle Termini, die sich direkt auf bestimmte Organe, Organteile und Gewebe beziehen. Das Interessante: Die alltäglichen Redewendungen, die die meisten Menschen direkt verstehen, stimmen treffsicher mit der hamerschen Germanischen Heilkunde® bzw. der Universalbiologie überein – es ist, als würde sich über sie eine Art Weltsprache offenbaren.
Die Organsprache entwickelte sich durch Beobachtungen, die unsere Vorfahren machten. Beispielsweise erkannten unsere Ahnen, dass jemand nach einem Wutausbruch gallig erbrechen musste („Mir läuft die Galle über“) oder eine Wunde am Ende der Heilung kribbelt („Wenns juckt, dann heilts“). Wir wissen auch: „Schlaf ist die beste Medizin“ – dementsprechend suchen sich verletzte Tiere ein ruhiges und sicheres Versteck zum Schlafen! Noch heute wissen wir, dass es das Dümmste ist, jemanden zu wecken, der krank ist. So etwas passiert normalerweise nur im Krankenhaus …
Wenn wir Wunden auf der Haut und der Seele haben, nicht atmen können und uns „Luft machen“ müssen, dann zieht es uns an die See oder in den Wald – eine Reha oder Kur können das oft nicht richten, dass wir uns wieder „wohl in unserer Haut fühlen“, denn meistens lenken diese Einrichtungen durch die Vielzahl an Therapien nur vom Kern unseres Befindens ab. Aus diesem Grund schmeißt es die Rückkehrer oft wieder in den heißen Kessel zurück.
Bis in die 1980er-Jahre wussten die Nachbarn der Mutter im Dorf, dass sie deshalb einen Knoten in der Brust hatte, weil ihr Kind gestorben war – sie sprachen von einem „Kummer-Krebs“ (Sorge-/Streit-/Nestkonflikt).
Mit dem Wissen der Universalbiologie können wir die Sprache der Organe auch als biologischen Redestil bezeichnen, da er erstaunlich passgenau Wiederherstellungsphasen („Es brennt unter den Nägeln“), hängende Heilungen (man hat „einen Kloß im Hals“) oder konfliktive Phasen („Es stößt mir sauer auf“) widerspiegelt.
Manchmal wirkt genau das: eine homöopathische Dosis an Worten. Literatur, die das beschreibt, worunter man leidet. Sätze, die enthalten, was das eigene Leben beschwert. Verdichtet, in hoher Konzentration der Organsprache liest man einen Satz, der die Verbindung schafft, und trifft auf Einverständnis – und damit auf das Zauberwort, das zum Weg in die Heilung führt.
In der biologischen Sprache der Organe tut nicht der Kindermund, sondern der Volksmund Wahrheit kund.
Das Herz
„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“
Antoine de Saint-Exupery, „Der Kleine Prinz“
So wie wir materialisierter Geist sind, so stellen unsere Worte, Sätze und Redewendungen, die aus der Tiefe kommen, die Verbindung zwischen unserer Seele und dem Körper her. Sie stammen aus unserem Geist, der die Verknüpfung zwischen Verstand und Herz herstellt. Aus dieser Verbindung stammt die Sprache der Organe.
Manche Sätze, die aus Unachtsamkeit gesprochen werden, können mit einer Wucht auftreffen, dass man meint, sie würden einem Höllenkarussell entspringen, das unkontrollierbar im Kopf herumwirbelt. Sie können das Gegenüber erstarren lassen. Diese Sätze, die jemanden einfrieren, (ab-)spalten, entsetzen und empören, manifestieren sich in körperlichen Symptomen. Ein Buchstabe kann ein Wort verändern, ein Satz ein ganzes Leben. Es sind diese Worte, die unsere Psyche aufnimmt und die direkt im Herz landen – im negativen, aber auch im positiven Sinn. Ein Ausdruck, eine Situation kann uns „das Herz aufgehen lassen“ oder uns mit einem „Stich im Herzen“ zurücklassen.
Deutet man die Sprache der Organe im Rahmen der Universalbiologie, kann herausgefunden werden, welcher Konflikt samt der „festgehaltenen“ Emotion das Schockerlebnis nicht verarbeiten lässt.
Wir beginnen mit dem „springenden Punkt“, den schon Aristoteles so benannte: Er meinte damit jenen pulsierenden roten Fleck, der im befruchteten Hühnerei nach dem dritten Tag der Bebrütung mit bloßem Auge zu erkennen ist. Für ihn war es das erste Zeichen des Lebens: die Herzanlage. Doch was oder wer gibt den ersten Impuls für den Herzschlag? Hier sind sich alle Kulturen einig: Wenn die Seele in das Herz gelangt, beginnt das Herz zu schlagen.
Die Sprache des Herzens ist eindeutig. Sie sagt „Liebe mich, erhöre mich“, wenn es um die Revierbereiche geht. Ist unser Liebster, unsere Liebste zugegen, wird uns „warm ums Herz“, da es entzündet und entflammt wurde – es brennt in Liebe zu jemandem, an den wir unser „Herz verschenkt“ haben.
Warm ums Herz wird uns aber auch, wenn wir das machen können, was wir freudig angehen. Aus diesem Grund betrifft die Belastung des Revierverlustkonfliktes oder sexuellen Frustrationskonfliktes auch alle Engagements in verschiedenen Bereichen, die uns „lieb und teuer“ sind – die uns „ans Herz gewachsen“ sind, uns „am Herzen liegen“, weil unser „ganzes Herz dranhängt“. Das reicht von der Kunst über die Wohnung bis zum Beruf. Manchen Menschen „geht das Herz auf“, wenn sie nach der Arbeit endlich ihren Hund wieder drücken können. Auch der Vierbeiner ist dann voller Freude und überglücklich, sie zu sehen. Ein „Herz für Tiere“ fließt in beidseitiger Richtung!
Unser Herz kann aber auch „gebrochen“ werden – es „zerreißt uns das Herz“, wenn wir eine „lieb gewonnene“ Sache verlieren. Wir „erkranken“ an „Herzeleid“ und „Herzschmerz“; es geht uns „zu Herzen“, weil wir es uns zuvor „zu Herzen genommen“ haben.
Das Märchen vom „Froschkönig“ beschreibt solch ein Herzeleid und die Befreiung davon sehr eindrücklich:
„Heinrich, der Wagen bricht!“
„Nein, mein Herr, der Wagen nicht, es ist ein Band von meinem Herzen, das da lag in großen Schmerzen, als Ihr in dem Brunnen saßt, als ein Frosch Ihr wart.“
So endet das Märchen vom Froschkönig. Weil der junge Prinz in einen Frosch verzaubert wurde, meinte sein Diener, das Herz müsse ihm zerbrechen. Deshalb ließ er sich eiserne Bänder um sein Herz schmieden. Doch als der Zauber seine Kraft verlor und der Prinz mit seiner Braut auf sein Schloss fuhr, sprangen die Schutzbänder mit lautem Krachen vom Herzen Heinrichs. Er brauchte sie nicht mehr.
Man kann auch „sein Herz verlieren“ oder „sein Herz verschenken“. Einer ostasiatischen Weisheit zufolge sind Menschen, die dafür bestimmt sind, einander ohne Rücksicht auf Zeit, Ort oder Umstände zu begegnen, durch einen „roten Schicksalsfaden“ verbunden. Die Farbe Rot symbolisiert das Herz – man ist „ein Herz und eine Seele“. Der Faden mag sich dehnen oder verheddern, reißen aber wird er nie. Wir alle haben schon von greisen Lebenspartnern gehört, die wenige Tage nacheinander sterben. Viele denken, dass dies Krankenhaus-Seemannsgarn sei, doch die Praxis spiegelt genau dies wider: Verwitwete Menschen folgen ihrem Partner binnen kürzester Zeit ohne eindeutige medizinische Diagnose – aber aus einem großen Kummer heraus, der „das Herz zerbricht“. Da dies häufiger geschieht als gedacht, bezeichnen Mediziner dieses Geschehen als „Gebrochenes-Herz-Syndrom“ – fachsprachlich: Stress-Kardiomyopathie. Dieses Broken-Heart-Syndrom, das zunächst für einen Herzinfarkt gehalten wird, da die Symptome sich manchmal ähneln, entwickelt sich gewöhnlich in aller Stille, klammheimlich und sehr häufig sogar ohne Begleitsymptome.
Menschen mit einem „weichen Herzen“ fühlen sich dazu berufen, andere zu unterstützen, und helfen, wo sie nur können. Ein „Nein“ ist nicht in ihrem Wortschatz enthalten – niemand wird abgewiesen. Sie haben ein großes Herz für die Sorgen und Nöte ihrer Mitmenschen. Auf der organischen Ebene betrifft das weiche Herz die Kammermuskulatur, die konfliktiv tatsächlich „ausdünnt“ und somit etwas softer erscheint. Menschen mit „viel Herz“ können jedoch bei häufigen Rezidiven tatsächlich unter einem zu großen Herzen leiden, da das Myokard sich nach jeder Lösung etwas mehr verdickt (Luxusgewebe). Mit der Zeit und bei ständigen Wiederholungen stellt sich diese Charaktereigenschaft des weiten Herzens dann auch auf der körperlichen Ebene als Dilatation (Herzerweiterung) und Herzinsuffizienz dar. Je nach Ausmaß kann man dann unter Wassereinlagerungen (vorwiegend an den Füßen, die beim Hochlagern weniger werden), Atemnot, Müdigkeit und gegebenenfalls unter Bluthochdruck leiden.
Der Herzbeutel, der wie ein Schutzschild das Organ umschließt, hat die Aufgabe, es vor Angriffen zu schützen. Wenn beispielsweise ein Ehepartner einen Herzinfarkt erleidet, kann die Frau dies als Attacke auf ihr eigenes Corazón erleben. Solch ein leidendes Herz verdickt das Perikard, das es umschließt, aus Schutz vor der empfundenen Attacke. Wenn dieser Kummer nicht nachlässt und man ständig die Bedrohung bzw. die Sorge empfindet, dass der Partner einen erneuten Infarkt erleiden könnte, bildet sich ein Panzer um das Herz. Die Schulmedizin spricht von einem „Panzer-Herz“. Es ist vielleicht schwer vorstellbar, aber das alles geschieht, damit wir weiterleben können.

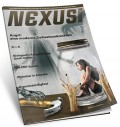
 Die Seele spricht – aber hören wir sie auch? Versteckt in Alltagsfloskeln teilen wir uns mehr über unsere inneren Zustände mit, als uns bewusst ist. Zeit, einen Wortschatz zu heben, der uns in einer uralten Zeitkapsel überliefert wurde.
Die Seele spricht – aber hören wir sie auch? Versteckt in Alltagsfloskeln teilen wir uns mehr über unsere inneren Zustände mit, als uns bewusst ist. Zeit, einen Wortschatz zu heben, der uns in einer uralten Zeitkapsel überliefert wurde.
Kommentare
14. Dezember 2025, 12:33 Uhr, permalink
Koch Gerhard
Gut erklärte Worte für unsere seelischen Ereignisse, deren Auswirkungen über die Selbstheilungs über unseren ganzen Körper, incl. des Geistes gehen. Gefällt mir sehr
Kommentar schreiben