AK: Ich würde es etwas anders formulieren: Die Technologie, einen Schlitz zu implementieren, steigert den Wirkungsgrad bei jedem Rotorblatt – denn sie beschränkt sich ja nicht auf Windkraft-Rotorblätter. Aber man kann ja nicht an allen Fronten gleichzeitig loslegen, weshalb wir uns damals auf die Windkraft und Ventilation beschränkten, nebst einem kleinen Ausflug zu den Schiffspropellern. Das Patent habe ich nach dem Reinfall mit der Firmengründung auslaufen lassen.5 Damit wurde es zum „Stand der Technik“, was heißt, dass jeder das Prinzip nutzen, aber niemand es monopolisieren kann.
Ich dachte auch, dass die Industrie an einem höheren Wirkungsgrad interessiert sei, doch nicht eines der vielen Dutzend kontaktierten Unternehmen zeigte dieses Interesse – jedenfalls nicht mir gegenüber. Im Laufe der Zeit stellte sich heraus, dass es mehrfach Versuche gegeben hat, die Technologie zu stehlen, was ich bis heute nicht verstehe. Denn ich hatte stets betont, dass ich als Patentinhaber mit einem Prozent der Gewinne zufrieden sei, sofern es zu einer langfristigen Lizenzvergabe komme. Vielleicht dachten die, ich sei unseriös, da Erfinder ja oftmals 20 Prozent und mehr verlangen?
DW: Lassen Sie uns noch weiter in Ihrem Fundus graben. Ihnen sind ja über die Jahre Tausende Technologien begegnet, ob Sie die nun selbst in Augenschein genommen oder nur recherchiert haben. Welches waren Ihre eindrücklichsten Erfindungen?
AK: Das ist kaum zu beantworten, da es in jedem Bereich Dutzende, wenn nicht gar Hunderte toller Entwicklungen gibt. Nehmen wir zwei als Beispiel, eine alte und eine neue: Da wäre zum einen das „Wirbelrohr nach Ranque und Hilsch“ von 1928, das jahrzehntelang einfach ignoriert wurde, vermutlich, weil niemand seinen Effekt erklären konnte. Denn es ist schon verblüffend, wie ich aus eigener Anschauung bestätigen kann, wenn ein einfaches, zweiteiliges Rohr ohne jegliche weiteren mechanischen oder gar beweglichen Teile Druckluft mit Raumtemperatur so separieren kann, dass alle heißen Moleküle aus der einen und alle kalten aus der anderen Öffnung herausströmen. Wohlgemerkt, das waren bei dem selbst gelöteten Exemplar plus 60 °C auf der einen und minus 40 °C auf der anderen Seite! Mir sind mindestens zwei Generationen Ingenieure und Wissenschaftler begegnet, die noch nie in ihrem Leben davon gehört haben – obwohl professionelle Wirbelrohre seit 1974 hergestellt werden.6 Eine Neuentwicklung, die jeder leicht nachvollziehen kann, ist der auf Resonanz basierende „Windbelt“ von Shawn Frayne aus dem Jahr 2004. Denn wer hat noch nie bemerkt (und gehört!), wie eine fest gespannte Zeltleine im Wind zu sirren beginnt? Was Frayne dazu veranlasste, auf ein derartig im Wind schwingendes Gummiband einen kleinen Magneten zu kleben, der zwischen zwei fest installierten Spulen genügend Energie umwandelte, um mehrere LEDs zum Leuchten zu bringen.7 Aber wie so oft sehen wir niemanden, der sich mit einer Weiterentwicklung oder Skalierung beschäftigt. Die Industrie konzentriert sich bei ihren Umsetzungen leider meist auf nur eine einzige Variante und weicht davon auch nicht mehr ab, selbst wenn es wesentlich effektivere Modelle gibt. Was unter anderem am Aufbau der Produktionsstraßen liegt, die man nur schwer modifizieren kann.
DW: Können Sie mir ein oder zwei Beispiele dafür nennen? Also für Technologien, von denen es inzwischen weitaus effizientere Modelle gibt?
AK: Bleiben wir bei den Windkraftwerken als Beispiel. Warum sehen wir heute 99 Prozent aller Anlagen mit Dreiblatt-Rotoren? Obwohl es auch welche mit nur einem Blatt gab (z. B. Monopteros von MBB), mit zwei (Hütter-Rotoren, Growian), vier oder noch mehr Blättern. Einmal ganz abgesehen von den Senkrechtachsern (Savonius, Darrieus u. a.) oder von gänzlich anderen Konstrukten, von denen es sehr, sehr viele gibt.8
Dafür, dass sich die Dreiblatt-Rotoren durchgesetzt haben, gibt es einige technische Gründe – aber witzigerweise auch psychologische: Es stellte sich nämlich heraus, dass Zweiblatt-Rotoren optisch „belastend“ sind, wenn sie bei ihrer Drehung immer wieder parallel zum Mast stehen – und dann schlagartig daraus ausbrechen. Der Mensch kann da nicht lange hinschauen.
Inzwischen wurden aber diverse, völlig andere Technologien entwickelt, die auch ganz ohne Rotoren auskommen. Diese werden vielleicht ein wenig erforscht, doch reale Chancen auf einen breiten Einsatz haben sie nicht, denn inzwischen produziert die Industrie schon 10-MW-Anlagen (mit drei Blättern!) und wird davon in den nächsten Jahrzehnten auch nicht mehr abrücken, denn zu viel wurde in diese Technologielinie investiert.
DW: Aber die anderen Anlagen wären weitaus effizienter gewesen, wenn ich Sie richtig verstehe?
AK: Teilweise ja, aber es geht nicht nur um die Effizienz, sondern auch um Ästhetik und Akzeptanz (Stichwort: Verspargelung der Landschaft), um Diversifikation und darum, dass die Potenziale anderer Umsetzungsformen oftmals gar nicht erst erforscht werden. Weshalb sie im besten Fall eine winzige Nische besetzen können, wie heute beispielsweise die Senkrechtachser (Savonius, Darrieus, Flettner usw.).
Ich bin sicher, dass es viele Menschen gibt, die sehr an völlig lautlosen und ebenso völlig bewegungsfreien Methoden interessiert wären, die Windkraft zu nutzen. Aber wer kennt schon die EWICON-Versuche an der TU Delft (Electrostatic Wind Energy Converter), die auf ein 1977 angemeldetes Patent von Alvin M. Marks zurückgehen, das einen blattlosen Ionenwind-Generator betrifft?9 Da müsste noch viel intensiver geforscht werden. Vergessen wir nicht, dass Ionentriebwerke bei Satelliten bereits zum Standard gehören; ein Team des Massachusetts Institute of Technology (MIT) um den von „Star Trek“ inspirierten Prof. Steven R. H. Barrett hat kürzlich sogar ein Modellflugzeug mit Ionenwind betrieben. Ebenso fliegt die mit zwei mal zwei Zentimetern vermutlich kleinste Drohne der Welt, entwickelt an der UC Berkeley, mit vier elektrohydrodynamischen (EHD-)Triebwerken.
Wenn Sie wissen wollen, wie viele Technologien es gibt, die das embryonale Stadium nie verlassen haben, dann scrollen Sie sich durch die Aufstellung im Teil C unter „Windenergie“ – „Neue Designs und Rotorformen“. Und ja, es befindet sich auch vieles darunter, das eher lustig als ernst gemeint ist – doch ein Lacher zwischendurch ist doch entspannend, oder nicht?
DW: Wow. Manche dieser Designs sehen nicht nur futuristisch, sondern richtiggehend ästhetisch aus – so einen IWEC, Dela- oder Schlaufenrotor hätte ich lieber auf den Feldern als unsere Spargel. Es ist schon traurig, dass es auch im Energiesektor nur „Monokulturen“ in die Landschaft schaffen – der menschliche Erfindungsreichtum ist doch viel bunter. Was meinen Sie: Woran liegt das? Eine Vielfalt in der Energieerzeugung wäre doch wünschenswert.
AK: Ganz meiner Meinung. Die Gründe für die technischen Monokulturen sind wohl die gleichen wie bei den landwirtschaftlichen: Zu eng definierte wirtschaftliche Interessen, die alles Störende eliminieren. Sei dies nun ein neuartiger Rotor oder ein sogenanntes Unkraut …
DW: Welche der von Ihnen zusammengetragenen Technologien wären denn hier und heute einsatzbereit und bräuchten nur eine Anstoßfinanzierung – oder schlicht nur einen Interessenten, der das Thema anpackt und vermarktet?
AK: Nehmen wir die leidige Diskussion um Elektroautobatterien. Eine der ältesten und wirtschaftlichsten Chemiken ist die der Blei-Säure-Batterie, die jedoch als zu schwer abgetan wird … als ob es keine Fortschritte bei den Materialwissenschaften gibt, aufgrund derer sich Bleiplatten heutzutage auch aus Bleischaum herstellen lassen, was das Gewicht extrem reduziert und dazu die Reaktionsfläche einer Platte auf die eines Fußballfeldes erweitert. Fragen Sie mich bitte nicht, warum sich damit nur eine einzige kleine Firma beschäftigt.
DW: Wie heißt denn die Firma?
AK: Es handelt sich dabei um die im Jahr 2003 gegründete Firma Firefly Energy Co., die 2006 mit ihrer Weiterentwicklung an die Presse ging. Inzwischen wird dort aber Kohlenstoff-Schaum verwendet. Es gibt aber noch andere Entwickler, wie z. B. Robert R. Aronsson, der im Jahr 2006 für seine „Multi-cellular electrical battery“ das Patent erhielt, in welchem explizit von Bleischaum gesprochen wird – oder Dr. Malchasi Aitsuradze aus Georgien, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Maschinenbau der Bergakademie Freiberg, der im Mai 2011 eine neuartige Bleischaumbatterie vorstellte.10
Aber wenn Sie heute die Begriffe „Bleischaum“ und „Batterie“ googeln, ist das aktuellste Ergebnis genau zehn Jahre alt! Da stimmt doch was nicht.
DW: Meinen Sie, hier wird bewusst auf die oben genannte Monokultur abgezielt? Oder ist das ein systemimmanentes Problem, sprich eins der Massenanfertigung? Fehlt den Alternativen einfach die Publizität? Ich meine, wie eingangs gesagt: Es müsste sich doch beim Stand der Klimadiskussion jede Regierung alle zehn Finger nach funktionierenden Alternativen lecken … oder zumindest könnten die FFF-Kids doch mit den Lösungen auf die Straße gehen.
AK: Ich denke, Ihre ersten beiden Fragen sollten Sie einem Technikhistoriker stellen. Ich tendiere dazu, die Investitionen in Produktionslinien als die Hauptschuldigen zu bezeichnen, denn diese sollen sich ja möglichst schnell amortisieren und anschließend viele Jahre lang Gewinne erwirtschaften. Damit ist diese Form des Wirtschaftens äußerst zögerlich gegenüber jeder Innovation, die den Ablauf stören könnte.
Die mangelnde Publizität ist ein weiterer Baustein zum Erhalt des Status quo. Und wenn einmal über irgendetwas Neues berichtet wird, dann verschwindet es anschließend wieder aus der Berichterstattung – oftmals auf Nimmerwiedersehen. Es gibt inzwischen zunehmend mehr Informationen, die sich im Netz nur noch im „Buch der Synergie“ finden lassen. Suchen Sie z. B. einmal nach Technologien mit einem Wirkungsgrad über 100 Prozent, die es der klassischen Physik zufolge gar nicht geben darf. Ich beziehe mich hier auf eine im März 2011 veröffentliche Studie amerikanischer Physiker der Colorado School of Mines um Mark Lusk, die bald darauf von Wissenschaftlern der Universität von Texas sowie von einer zweiten Gruppe um Matthew Beard am National Renewable Energy Laboratory (NREL) praktisch bestätigt wurde. Die untersuchte MEG-Solarzelle (= Multiple Exciton Generation) hat tatsächlich einen Wirkungsgrad von 114 Prozent erreicht.11 Oder der Fall der LED, die 2012 am Massachusetts Institute of Technology (MIT) von einem Team um Parthiban Santhanam entwickelt wurde und eine Effizienz von 230 Prozent erreichte.12 In diesen Fällen sind wenigstens die Originalstudien noch einsehbar, doch in den Mainstreammedien suchen Sie vergeblich danach.
Regierungen mögen sich zwar die Finger lecken, aber aufgetischt bekommen sie von ihren Experten und Fachgremien nur die Brötchen vom Vortag. Man will schließlich seriös bleiben und auch den nächsten Beraterauftrag an Land ziehen.
In Deutschland kann man in Bezug auf neuartige Energietechnologien eigentlich nur eine einzige Ausnahme finden: Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gab einen Bericht in Auftrag, der dann 2005 unter dem Titel „Zukunftstechnologien für nachhaltige Entwicklung: Unkonventionelle Ansätze zur Energiegewinnung und Aktivierung biologischer Prozesse“ erschien. Die Verfasser sind Marco Bischof, Thorsten Ludwig und Andreas Manthey, gute Freunde von mir. Natürlich lässt sich der 61-seitige Bericht als PDF im Archiv im „Buch der Synergie“ finden.13
Zu Ihrem letzten Nebensatz: Leider sind die Greta- und ebenso die FFF-Kids auf eine wenig konstruktive Haltung gepolt – indem sie ausschließlich gegen bestehende Mängel protestieren. So fingen damals auch die Vorläufer der Grünen an, Greenpeace und fast alle anderen. Das war und ist ja auch wichtig, doch es dauerte Jahrzehnte, bis die Betreffenden kapierten, dass man sich gleichzeitig für etwas einsetzen sollte. Und dies möglichst zu mehr als 51 Prozent, denn wenn man nur auf dem Bremspedal steht, bewegt sich die Karre gar nicht mehr.
DW: Das sehe ich ganz ähnlich, deshalb versuche ich, gleich noch etwas mehr aus Ihnen herauszukitzeln: Gibt es denn Technologien, die Ihnen im Lauf Ihrer Recherchen untergekommen sind, die Sie selbst nutzen? Oder können Sie etwas empfehlen, von dem Sie sagen: Das ist einfach so gut, davon müsste zumindest jeder wissen? Bitte picken Sie sich, falls es wieder Hunderte Beispiele gibt, ein paar heraus.
AK: Das ist die schwierigste Frage, die Sie mir stellen – zumindest der zweite Teil. Zum ersten muss ich leider sagen, dass ich als Mieter mitten in Berlin kaum etwas von dem anwenden kann, das ich im „Buch der Synergie“ beschreibe. Natürlich habe ich diverse kleine Funktionsmodelle, angefangen von einer Kurbeltaschenlampe über thermoelektrisch betriebene LEDs und sogenannte Handwärme-Stirlings bis hin zu einer Solardestille. Diese dienen aber eher der Anschauung bei Vorträgen.
Als ich hingegen in unserem Landhaus in der Ost-Ghouta bei Damaskus lebte, das später durch islamistische Terroristen vollständig zerstört wurde (wobei sie auch die wunderbaren, gut 800 Jahre alten Olivenbäume abschlugen und verkauften), nutzte ich neben dem Warmwasser der Solaranlage tagsüber auch regelmäßig einen selbstgebauten Solarkocher, um z. B. Tee zu machen. Das sparte nicht nur das sonst erforderliche Haushaltsgas, sondern ging auch beträchtlich schneller.
Wenn Sie mich nach Beispielen fragen, von denen „zumindest jeder wissen müsste“, verweise ich einmal auf die jüngst recherchierten Solarfenster,14 denn diese könnten einen äußerst disruptiven Einfluss haben: Bislang wurden Solaranlagen horizontal und daher mit großem Flächenbedarf realisiert, was auch auf schwimmende Anlagen (auf Kanälen, Speicherbecken usw.) zutrifft. Nun wurden aber in den letzten Dekaden unzählige Technologien erforscht und teilweise sogar bis zur Marktreife entwickelt, um aus normalen Glasfenstern Solarkraftwerke zu machen. Die oftmals ökologisch kritisierten Hochhäuser aus Stahl und Glas könnten damit auf einen Schlag ihren gesamten Strombedarf selbst decken – und noch genug Überschuss für die Nachbarschaft erwirtschaften. Das US-Energieministerium hatte letztlich ausgerechnet, dass alleine das Empire State Building – das wahrlich nicht als Glashochhaus bezeichnet werden kann – durch den Austausch aller Fenster genug Strom für den Bedarf von 3.500 Haushalten liefern könnte.

Solarfenster
Der elementare Gedanke dabei sollte aber sein, dass die Erweiterung der inzwischen als konventionell geltenden Solarzellen-Technologie auf eine neue Dimension – die Senkrechte – plötzlich unglaubliche Potenziale auftut, sodass selbst Experten sich gegen die Stirn schlagen und fragen, warum das niemand vorhergesehen hat.
Ein weiteres Beispiel wird unter dem Oberbegriff Micro Energy Harvesting zusammengefasst. Dabei geht es um die schier unendlichen Formen von Energie, die uns ständig umgeben, ohne als solche wahrgenommen zu werden, wie Schall und Vibrationen, Wärmeabstrahlung, biologisch-chemische Reaktionen, Luftfeuchtigkeit und Funkwellen. Erst in den letzten Jahren wurde damit begonnen, diese Quellen zu untersuchen und Techniken zu entwickeln, die zugegebenermaßen winzigen Energiemengen zu sammeln und zu konzentrieren, um damit die unterschiedlichen Geräte zu betreiben. Denn egal wie gering die Quantität der einzelnen Quellen sein mag, stehen diese ja ununterbrochen und ohne besonderen Aufwand zur Verfügung, und ein steter Tropfen kann selbst das größte Fass füllen.
DW: Wo wir gerade dabei sind: Kürzlich ist ja ein Buch erschienen, das Sie zusammen mit den Schneiders vom NET-Journal verfasst haben. Im Buch geht es ja meiner Auffassung nach ziemlich wild einher – von schwer zu spezifizierenden Neutrinoautos bis hin zu Vier-Kilo-Rucksäcken zum Handyladen. Da nimmt man doch lieber eine Kurbeltaschenlampe mit … Ich meine, Hand aufs Herz: Ist da nicht auch viel Quatsch dabei?

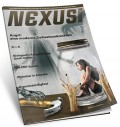
 Eine Begegnung mit der „Messias-Maschine“ und ihrem Erfinder katapultierte Achmed Khammas 1975 auf einen Pfad, den er nicht mehr verlassen hat. Bis heute trägt er im „Buch der Synergie“ ein Konvolut an Technologien zusammen, die uns in ein neues, nachhaltiges und naturnahes Energiezeitalter bringen könnten. Ein ausführlicher Dialog über seltsame und weniger seltsame Maschinen, Heureka-Momente und die Frage, warum wir immer noch nicht dort sind, wo wir eigentlich längst sein sollten.
Eine Begegnung mit der „Messias-Maschine“ und ihrem Erfinder katapultierte Achmed Khammas 1975 auf einen Pfad, den er nicht mehr verlassen hat. Bis heute trägt er im „Buch der Synergie“ ein Konvolut an Technologien zusammen, die uns in ein neues, nachhaltiges und naturnahes Energiezeitalter bringen könnten. Ein ausführlicher Dialog über seltsame und weniger seltsame Maschinen, Heureka-Momente und die Frage, warum wir immer noch nicht dort sind, wo wir eigentlich längst sein sollten. Daniel Wagner ist Herausgeber und Chefredakteur des deutschen NEXUS-Magazins. Wenn er nicht gerade damit beschäftigt ist, fremde Texte zu bewerten und den bürokratischen Apparat zu füttern, greift er selbst zur Feder. Seine Interessen flattern am Horizont.
Daniel Wagner ist Herausgeber und Chefredakteur des deutschen NEXUS-Magazins. Wenn er nicht gerade damit beschäftigt ist, fremde Texte zu bewerten und den bürokratischen Apparat zu füttern, greift er selbst zur Feder. Seine Interessen flattern am Horizont.
Kommentar schreiben